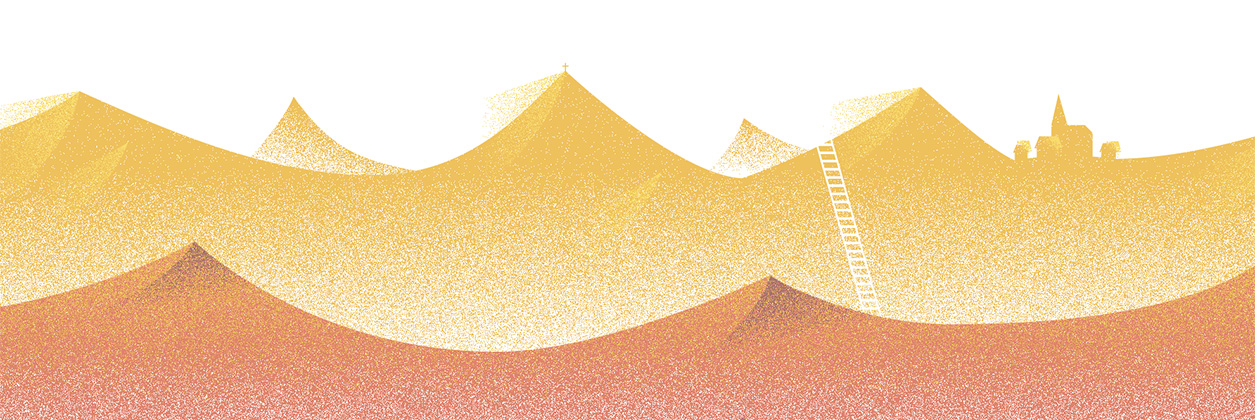
Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft. Das ist eine Binse. Wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht, verrät jedoch viel über diese Gesellschaft. Das Land Tirol hat sich vorgenommen, allen Kindern ab dem zweiten Geburtstag bei Bedarf einen Platz in einer Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort zu vermitteln. Es besteht also – auf diese Unterscheidung legt Karl-Josef Schubert Wert – nicht das Recht auf einen Platz, sondern lediglich auf die Vermittlung eines solchen. Das ist nicht bloß ein semantischer Unterschied. Fest steht, dass dieses Recht Geld kostet. Das Land hat angeschafft, bleiben die Gemeinden nun auf der Rechnung sitzen? Jein. „In manchen Gemeinden wird dadurch ein finanzieller Mehraufwand entstehen, in Summe sollten sich zusätzlicher Aufwand und finanzielle Zuwendungen allerdings für die Gemeinden die Waage halten“, sagt Schubert, der hinter dem grundsätzlichen Bekenntnis steht, jedem Tiroler Kind unabhängig von dessen Wohnortgemeinde eine ausreichende elementarpädagogische Betreuung anbieten zu können.
Äußerst prekäre Finanzlage
„Den Tiroler Gemeinden geht es finanziell wirklich schlecht“, sagt Karl-Josef Schubert. Dieser Zustand ist nicht neu, aber anhaltend. Die Transferleistungen der Gemeinden an den Bund steigen wesentlich stärker als das, was wieder zurückfließt. „Da gab es Steigerungen zwischen fünf und acht Prozent, die Zunahme bei den Ertragsanteilen bleibt unter der Inflation“, erläutert Schubert. Das ist finanziell keine nachhaltige Situation. Es gibt in Tirol genügend Gemeindestuben, in denen die Budgeterstellung für 2026 auf mehr als wackeligen Beinen steht. Es geht den Gemeinden an die Substanz: Grundstücke werden verkauft, Reserven – sofern vorhanden – aufgelöst, Leistungen für die Bevölkerung teurer gemacht oder sogar zurückgenommen. Nicht nur die Investitionsfähigkeit der Zukunft ist gefährdet, sondern auch die Liquidität und damit die gegenwärtige Finanzierung. Schubert hofft, dass die Konjunktur bald anspringt, damit zumindest die Einnahmen aus der Kommunalsteuer steigen. Gegen die Ausgabendynamik ist das aber auch kein Mittel. Schubert kritisiert, dass in der Vergangenheit „der Bund und auch die Länder viele Aufgaben auf die Gemeinden abgewälzt haben, ohne dafür zu sorgen, dass sie finanziell bedeckt sind“.
Minimalistisch betrachtet müsse sich eine Gemeinde von Rechts wegen nur um die Dinge kümmern, die unmittelbar die Daseinsfürsorge betreffen, sagt Schubert. Dazu zählen Kinderbetreuung, die Aufrechterhaltung grundlegender Infrastruktur – Wasser, Kanal, Müllabfuhr, Straßen- und Wegenetz, Sicherheit der Bevölkerung durch ein funktionierendes Feuerwehr- und Rettungswesen – und die Altenbetreuung. Zwischen dieser Zuständigkeit der Gemeinde von der Wiege bis zur Bahre gibt es aber vieles, was nicht unbedingt notwendig ist. In die Kategorie „Nice-to-have“, sagt Schubert, fallen Dinge wie „ein toller Sportplatz, ein Fitnessparcours, ein Schwimmbad, mehr oder weniger alle Freizeitangebote, die Weihnachtsbeleuchtung, nicht einmal die Straßenbeleuchtung ist ein Muss.“ Gemeinden, die sich nur noch auf ihre Aufgaben in der Daseinsfürsorge beschränken, verlieren an Attraktivität. Und selbst notwendige Investitionen in diese Aufgaben werden auf später vertagt. „Was nicht unbedingt notwendig ist, wird in den meisten Gemeinden derzeit aufgeschoben“, weiß Schubert. Damit fallen die Gemeinden auch als Investitionsmotor für die regionale Wirtschaft aus. Karl-Josef Schubert neigt der Ansicht zu, dass die Gemeinden ihre Ausgaben durchforsten und nach höherer Effizienz streben sollten. Dann ließe sich auch bei annähernd gleichbleibender Dienstleistungsqualität etwas einsparen. „Die finanzielle Ressourcenknappheit bietet auch die Chance, Reformen anzugehen, vor denen man sonst zurückgescheut wäre“, hofft der Gemeindeverbandspräsident. Illusionen gibt er sich aber nicht hin. Dafür ist Schubert zu lange im Geschäft. „Wenn man in langen Verhandlungen und Überlegungen in der Verwaltung etwas wegbringt, kommt von anderer Seite wieder ein riesiger Verwaltungsbooster dazu.“
Licht ins Dunkel?
Konkret meint Schubert damit das Informationsfreiheitsgesetz (IFG), das seit September des Jahres in Kraft ist und den Zugang zu staatlichen Informationen regelt, indem es eine proaktive Veröffentlichungspflicht und ein Grundrecht auf Informationszugang schafft. Das ist zunächst einmal für die Bürger*innen eine positive Sache, weil das IFG Licht ins Dunkel bringt. Im Licht ist nicht gut munkeln und erst recht nicht mauscheln. „Information und Transparenz sind wichtig und gut, aber der finanzielle und zeitliche Aufwand, um Dokumente aus Gründen des Datenschutzes zu schwärzen, ist erheblich“, spricht Schubert aus eigener Erfahrung in seiner Gemeinde. Daher stellt sich für den Vomper Bürgermeister die Frage, ob dieser zusätzliche Verwaltungs- und Personalaufwand gerechtfertigt ist. Das Sprachrohr der Tiroler Bürgermeister rechnet damit, dass das IFG nach Evaluation auf mehr Praxistauglichkeit hin novelliert wird.
Zu Tode verwaltet ist auch gestorben
Gut gemeint, in der praktischen Umsetzung für die Gemeinden aber weniger gut getroffen dürfte auch die Energieeffizienzrichtlinie (EED) sein. Hier ortet Schubert „wie so oft ein Gold-Plating in der Umsetzung“, sprich die Übererfüllung von EU-Mindeststandards. Worum es geht: Der öffentliche Sektor muss laut EED jährlich mindestens drei Prozent seiner beheizten oder gekühlten Nutzfläche sanieren. „Mit dem guten Gedanken im Hintergrund, öffentliche Gebäude zu sanieren, ist die praktische Umsetzung der helle Wahnsinn“, sagt Schubert. Die Konsequenz: „Wir verwalten uns zu Tode. Und das kostet Geld.“ Für die Gemeinden sei in den letzten Jahrzehnten verwaltungstechnisch vieles sehr viel komplexer geworden. Dementsprechend steigt der Personalaufwand in den Gemeinden, die Kosten laufen nicht nur in der Verwaltung davon, sondern in allen Bereichen. Immer höhere Mindeststandards wollen schließlich nicht nur bestellt, sondern auch bezahlt werden.
Grund zur Reform
Die Gemeinden stehen zweifellos unter Druck, ihre Prozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten. Doch auch einnahmenseitig hat man in der Anhebung der Grundsteuer ein Pflaster ausgemacht, das zumindest kurzfristig Linderung verschaffen soll. „Die Grundsteuer wurde seit den 1970er-Jahren nicht angepasst und gehört schon dem Grunde nach reformiert“, argumentiert Schubert. Er spricht sich dafür aus, nicht einfach den sogenannten Hebesatz zu erhöhen, sondern eine grundlegende Reform anzugehen. „Aus Sicht der Gemeinden stehen wir einer Reform positiv gegenüber, weil es ein Einnahmenpotenzial gibt“, formuliert Schubert. Man müsse dabei nur aufpassen, dass die Verhältnisse und Voraussetzungen in Ostösterreich völlig andere seien als im Westen. Dort ist Grund verhältnismäßig billig, hier nicht. „Die Grundsteuer muss mit Augenmaß und variabel reformiert werden, damit sich das Wohnen in Tirol dadurch nicht weiter verteuert“, so Schubert, der einmal mehr dafür eintritt, zunächst die Ausgabenseite unter die Lupe zu nehmen, ehe Steuern erhöht werden.
Die Lage bleibt herausfordernd. Gemeindezusammenlegungen könnten zur Entspannung beitragen, brauchen jedoch den breiten Rückhalt der Bevölkerung. Den gibt es (noch) nicht. Allheilmittel wären auch Fusionen nicht. Solange die Ausgaben schneller wachsen als die Einnahmen, wird sich an der Geldnot der Gemeinden nichts ändern. Der Gemeindeverbandspräsident rückt zur Verteidigung der Gemeinden aus: „Die Tiroler Gemeinden wirtschaften nicht schlecht. Sie haben nur so viele Aufgaben vom Gesetzgeber übertragen bekommen, ohne dass die finanziellen Mittel vorhanden wären, um das alles bewerkstelligen zu können.“ Dieser Spagat führt dazu, dass die Kategorie „Nice-to-have“ immer weiter zusammengekürzt werden muss. Was muss, muss, alles andere wird in Tirols Gemeinden immer mehr zum Luxus.
Text: Marian Kröll
Foto: Ariane Frötscher

